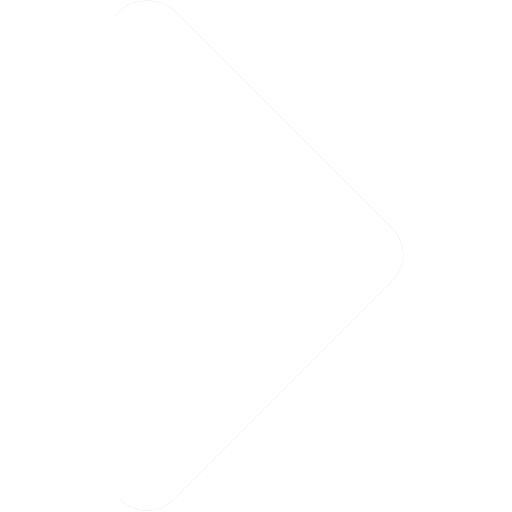Begadi Guides

| Hallo zusammen! |
|
In diesem Bereich möchten wir Informationen, Leitfäden und anderes, hilfreiches Material vorstellen, verlinken und zum Download anbieten,
eine stetig wachsende Sammlung an Spielhilfen und Infos!
Ein Teil der Inhalte wurde durch uns erstellt, vieles aber auch innerhalb der Community oder in Zusammenarbeit von begadi, mit der Community. Die inhalte sind entsprechend markiert. Der Service ist natürlich für alle Kunden kostenlos, wir weisen aber darauf hin, dass eine Vervielfältigung, komplette oder auszugsweise, Nutzung oder Verbreitung ohne unsere Zustimmung untersagt ist! |
| Technik: |
|
- Begadi Mosfet Guide - Wissenswertes über Mosfets
- Begadi Gearbox Guide - Wissenswertes über Gearboxen - Begadi Akku Guide - Wissenswertes zu Akkus im Airsoft - Begadi Blowback Guide - Übersicht und Grundwissen zu Blowback |
| Ausrüstung: |
|
- Begadi Zielhilfen Guide - eine Übersicht über Ziellhilfen, Stärken und Schwächen
- Begadi Magazin Guide - eine Übersicht über Magazine - Kleidung - wie funktioniert Isolation - ein Artikel, der euch hilft Bekleidung richtig auszuwählen |
Wir prüfen alle Inhalte, können aber keine 100% Kontrolle zu Richtigkeit, Vollständigkeit oder allgemeiner Gültigkeit geben.